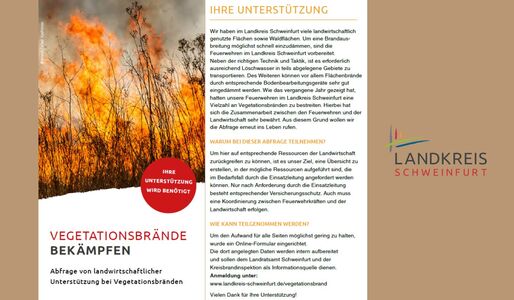Herzlich Willkommen auf der Homepage der Gemeinde Kolitzheim
Acht typisch fränkische Dörfer in einer Gemeinde vereint.
Entdecken Sie auf unseren offiziellen Internetauftritt alles Wissenwerte über unsere lebendige Gemeinde im südlichen Landkreis Schweinfurt, im Herzen Unterfrankens.
Von aktuellen Neuigkeiten, Projekten, Bekanntmachungen und Veranstaltungen bis hin zu Informationen über unsere Geschichte, der politischen Gremienarbeit, der Verwaltung und den gemeindlichen Einrichtungen und das vielfältige Vereinsleben - hier finden Sie alles, rund um die Gemeinde mit seinen acht Gemeindeteilen Gernach, Herlheim, Kolitzheim, Lindach, Oberspiesheim, Stammheim, Unterspiesheim und Zeilitzheim.
Tauchen Sie ein und erleben Sie, was unsere Gemeinde so besonders macht.
Aktuelle Informationen und Bekanntmachungen
Herzliche Einladung zum Gemeindefest
Bauplatzverkauf in den Gemeindeteilen Herlheim, Kolitzheim, Lindach und Unterspiesheim
Einsatzplanung im Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen: Vegetationsbrandbekämpfung - Einbindung der Landwirtschaft
„Gemeindedialog“ macht Halt in Kolitzheim
Bundesfreiwilligendienstleistende/r (m/w/d)
16. Autofreier Sonntag im Fränkischen Weinland

Heimat - mehr als ein Gefühl
Demografischer Wandel und sozialer Zusammenhalt in ländlichen Regionen Bayerns
Ein Forschungsprojekt zum Mitmachen!